Karlheinz Hausmann studierte Werkstoffwissenschaften an der Universtät Erlangen-Nürnberg und der ETH Lausanne. 1987 begann er seine Karriere bei DuPont de Nemours Intl SA in Genf, wo er auf verschiedenen Gebieten in der Polymerentwicklung tätig war und verschiedene Funktionen ausfüllte: Technischer Kundendienst, technische Marktentwicklung, Polymer- und Compoundentwicklung in den Bereichen der Ethylene, Copolymere, Fluoropolymere und technischen Polymere für die Anwendungsbereiche Verpackung, Autoinnenbereich und W&C.
Besonders gut kennt er sich mit Anwendungen für flexible Lebensmittelverpackungen (Extrusionsbeschichtung, Blasfilm, Foliendesign) und mit erneuerbaren, nachhaltigen und kompostierbaren Materialien und Materiallösungen für die Verpackungsindustrie aus. So ist es auch nicht verwunderlich, dass er auf der Tagung über “Nachhaltige Verpackungen – Lightweighting und Recyclierbarkeit” referiert.
Seine Lieblingsthemen sind die Ionomere (Surlyn®), Polymermodifikation und Biopolymere.
Die Tagungsüberschrift: “Umwelt- und umfeldgerechte Kunststoffverpackungen” beschreibt den Spannungsbogen zwischen Marketing-, Konsumenten- und Umweltanforderungen. Wie sehen Sie insgesamt, abgesehen von Ihrem Vortragsthema, die Rolle der Verpackung im gesellschaftlichen Umfeld? Verpacken wir richtig?
Das kommt drauf an, von welcher Seite Sie es betrachten- auf der einen Seite soll Verpackung schützen, auf der anderen Seite soll Verpackung gar nicht da sein, da sie als Störfaktor angesehen wird, der die Umwelt verschmutzt. Also arbeiten wir daran, die Verpackungsstoffe zu verringern, aber gleichzeitig den Produktschutz beizubehalten. Dies kann zu komplizierteren Strukturen führen, welche deswegen als schlecht recyclierbar eingeschätzt werden, aber in Wirklichkeit genauso gut recyclierbar sind wie ihre dickeren Vorgänger – sie müssen halt nur gesammelt und recycliert werden … dann stellt sich die Frage weniger.
Der Punkt ist doch, den Verpackungsaufwand zu minimieren und den Produktschutz zu maximieren.
Mit Ihrem Thema “Nachhaltige Verpackungen – Lightweighting und Recyclierbarkeit” leisten Sie einen inhaltlich sehr gut passenden Beitrag. Was genau werden Ihre Kernaussagen sein?
Minimierung des Verpackungsaufwandes bei gleichzeitiger Maximierung des Produktschutzes. Recyclierbarkeit ist gegeben und kann durch Kompatibilisatoren optimiert werden, solange der Abfall gesammelt wird.
An Beispielen wie dem Virtuous Circle in Südafrika kann das aufgezeigt werden. Auf diese Weise erhält der Recyclierprozess sowohl einen sozialen, wirtschaftlichen als auch umweltorientierten Gesichtspunkt. Mehrschichtfolienabfälle aus der Lebensmittelverpackung werden von Schulkindern gesammelt und kommen dann in Form von Schulbänken oder Häusern wieder in dieselben Communities zurück
Ein weiterer Gesichtspunkt ist das Design zur Recyclierbarkeit. Man sollte bestimmte Komponenten in flexiblen Kunstoffverpackungen minimieren oder vermeiden, um eine gute Recyclierbarkeit zu erzielen, so z. B. Papier, Aluminium oder vernetzte Laminierungsklebstoffe.
Sie als Rohstofflieferant setzen auf weniger Material. Wie passt das mit Ihren kommerziellen Absatzstrategien zusammen?
Wir wollen mit Spezialprodukten die Wertschöpfung, zu welcher diese Produkte beitragen, betonen und zur Nachhaltigkeit der jeweiligen Verpackungskonzepte beisteuern, gemäss dem Motto „weniger ist mehr“.
Medien und auch die öffentliche Meinung tendieren in jüngerer Vergangenheit eher zu Negativ-Darstellungen von Verpackungen insgesamt. Neben Umweltrisiken werden auch immer wieder Gesundheitsrisiken bemängelt. Wie schätzen Sie das Aufwand-Nutzen-Verhältnis von Verpackungen allgemein und von Kunststoffverpackungen insbesondere ein?
Ohne Verpackungen könnte man Produkte nicht sicher von A nach B transportieren. Vielen Menschen würden sichere und auch hoch qualitative Lebensmittel vorenthalten. Wollte man alle Kunststoffverpackungen durch Metall, Papier etc. ersetzen, wären der Verpackungaufwand und die Umweltbelastung viel grösser. Nur die flexible Kunststoffverpackung erlaubt es, das Produkt mit einem minimalen Kunstoffmaterialverbrauch zu schützen. Deswegen wird sie auch wahrscheinlich nicht gern gesammelt. Und hier muss das Umdenken ansetzen. Wenn sie gesammelt wird, kann die Recyclierung kostengünstiger sein und neue Märkte erschlossen werden.
Hinsichtlich Gesundheitsrisiken … das ist wohl mit allen Verpackungsarten verbunden, mit recyclierten Kartons wohl noch mehr als mit reinen Kunststoffen. Auch recyclierte Metalle können mit Verunreinigungen behaftet sein. Da hilft nur Kontrolle.
Folienverpackungen werden als Minimalverpackung bezeichnet. Doch in einem Punkt sind sich viele einig – das Recycling ist schwierig und belastet die Ökobilanz der Folie. Wie schätzen Sie diesen Nachteil im Vergleich zu Mehrweg- oder Pfandsystemen ein, wie es uns die Flaschenindustrie vormacht?
Alle Ökobilanzen, die ich gesehen habe, sind eigentlich vorteilhaft für Mehrschichtverpackungen, vor allem, wenn man den erzielten Nutzen, also die Vermeidung von Lebensmittelabfällen, mit einbezieht – aber das wird von vielen Leuten ignoriert. Man kann die Ökobilanzen von Verpackung und Lebensmitteln eigentlich nicht trennen – sie müssen als Ganzes gesehen werden. Der Co2 Footprint der Verpackung ist eigenlich klein gegenüber dem Co2 Footprint des Lebenmittels, das geschützt wird und dessen Verderb vermieden wird.
Auch der Umstand, dass ich mit einer dünnen Folienverpackung 90% des Materials einer dickeren Verpackung ersetzen kann, ist wichtig zu verstehen. Es ist schon mal schwierig, eine Recyclierungsrate von 90 % zu erreichen … und 10 % ist eigentlich nur der Abfall der dünneren Verpackung, welche ich max. produziere … recycliere ich diese dann, erhalte ich eine sehr positive Ökobilanz.
Achten Sie auf eine optimale Verpackung, wenn Sie privat einkaufen? Wählen Sie Produkte bewusst oder unbewusst nach der Verpackung und nicht nur nach dem Inhalt aus? Und wie wichtig stufen Sie als Verbraucher und Fachmann das Image eines Packmittels im Vergleich zu alternativen Packmitteln ein?
Ja, bei Fleisch achte ich darauf, Vakuumverpackungen zu kaufen, da diese weniger Material verbrauchen und besser schützen. Auch erachte ich „Mogelverpackungen“ als weniger sinnvoll und versuche das Verhältnis Produktgewicht/Verpackungsgewicht zu maximieren.
Ja, das Image eines Packmittels ist wichtig – ich versuche, Packungen aus Karton oder solche, die Papier zusammen mit dünnen Kunststoffolien enthalten, zu vermeiden (sehr schlechte Ökobilanz, Kontamination mit Mineralölen, Störung der Recyclierung, wenn mit Kunststoffen verbunden etc.)
Zum Schluss noch eine persönliche Frage: Was begeistert Sie außerhalb Ihres Berufes?
Reisen und das Kennenlernen fremder Kulturen.
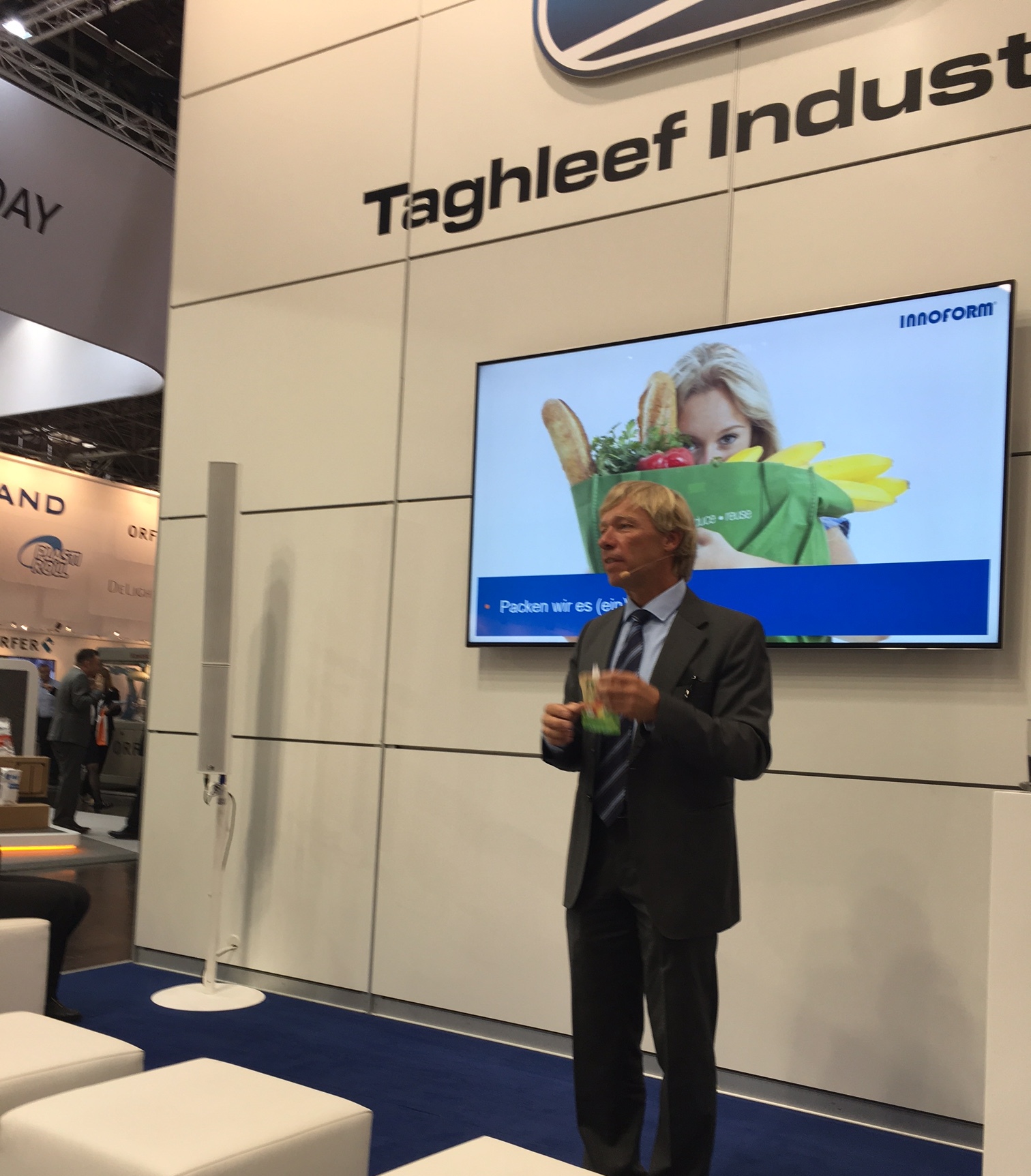 tenteils die Forderungen nach einer Kreislaufwirtschaft. Anschließende Diskussionen brachten interessante Aktivitäten zu Tage. So berichtete ein Senegalese, dass er 2500 Mitarbeiter beschäftigte, die Müll (vorzugsweise Verpackungsmüll) sammelten, den er dann rentabel rezykliert – auch eine Art von Kreislaufwirtschaft! Mehr Infos unter www.inno-impuls.com
tenteils die Forderungen nach einer Kreislaufwirtschaft. Anschließende Diskussionen brachten interessante Aktivitäten zu Tage. So berichtete ein Senegalese, dass er 2500 Mitarbeiter beschäftigte, die Müll (vorzugsweise Verpackungsmüll) sammelten, den er dann rentabel rezykliert – auch eine Art von Kreislaufwirtschaft! Mehr Infos unter www.inno-impuls.com











 Essen Sie noch Bioprodukte oder schon vegan? Kaufen Sie Ihr Müsli beim Discounter oder bestellen Sie Ihr Designmüsli schon im Netz? Machen Sie eine Medien- oder Plastikdiät oder wollen Sie tatsächlich noch an Gewicht abnehmen?
Essen Sie noch Bioprodukte oder schon vegan? Kaufen Sie Ihr Müsli beim Discounter oder bestellen Sie Ihr Designmüsli schon im Netz? Machen Sie eine Medien- oder Plastikdiät oder wollen Sie tatsächlich noch an Gewicht abnehmen? Ich denke, es wird dringend Zeit, auch auf internationaler Ebene als Packmittelindustrie – sogar unabhängig vom Packstoff – eine klare Aussage zu erarbeiten, die deutlich macht, welchen Nutzen Verpackungen stiften und welche Hausaufgaben noch vor uns liegen. Ansätze wie der
Ich denke, es wird dringend Zeit, auch auf internationaler Ebene als Packmittelindustrie – sogar unabhängig vom Packstoff – eine klare Aussage zu erarbeiten, die deutlich macht, welchen Nutzen Verpackungen stiften und welche Hausaufgaben noch vor uns liegen. Ansätze wie der 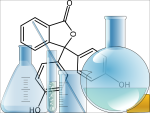 Bei chemischen Kreisläufen hält man die Zahl der eingesetzten Chemikalien gering und vor allem unter stetiger Kontrolle. Ein Beispiel dafür ist, dass Kunststofffenster verliehen werden und der Produzent diese nach einer vereinbarten Laufzeit wieder zurückerhält, um daraus wieder Kunststofffenster herzustellen. Das hat mehrere Vorteile:
Bei chemischen Kreisläufen hält man die Zahl der eingesetzten Chemikalien gering und vor allem unter stetiger Kontrolle. Ein Beispiel dafür ist, dass Kunststofffenster verliehen werden und der Produzent diese nach einer vereinbarten Laufzeit wieder zurückerhält, um daraus wieder Kunststofffenster herzustellen. Das hat mehrere Vorteile: Hier spielt die Natur die dominierende Rolle, auch wenn der Mensch ihr dabei gehörig ins Handwerk pfuschen wird. Wir nutzen die Natur – z. B. Pflanzen – um Rohstoffe zu gewinnen, die wir der Natur wieder zurück geben können. Also nicht nur Biopolymere, die aus Pflanzen stammen, sondern eben auch solche, aus denen wieder Pflanzen wachsen können. Also bio-basierte (bio-based) Materialien, die aber auch bioabbaubar (bio-degradable) sind. Der große Vorteil dieser Polymergruppe besteht darin, dass man sie so designen könnte, dass sie auch ohne funktionierende Sammel- und Entsorgungssysteme in die Natur „entlassen“ werden, wieder nutzbringend sind und nicht hunderte von Jahren in Meeren treiben und Fische malträtieren.
Hier spielt die Natur die dominierende Rolle, auch wenn der Mensch ihr dabei gehörig ins Handwerk pfuschen wird. Wir nutzen die Natur – z. B. Pflanzen – um Rohstoffe zu gewinnen, die wir der Natur wieder zurück geben können. Also nicht nur Biopolymere, die aus Pflanzen stammen, sondern eben auch solche, aus denen wieder Pflanzen wachsen können. Also bio-basierte (bio-based) Materialien, die aber auch bioabbaubar (bio-degradable) sind. Der große Vorteil dieser Polymergruppe besteht darin, dass man sie so designen könnte, dass sie auch ohne funktionierende Sammel- und Entsorgungssysteme in die Natur „entlassen“ werden, wieder nutzbringend sind und nicht hunderte von Jahren in Meeren treiben und Fische malträtieren. Momentan favorisieren viele die Mischung aus beiden Kreisläufen mit mehreren möglichen Abzweigungen in andere Kreisläufe, aber eben auch in Sackgassen wie die Verbrennung. Wird beispielsweise ein Biomaterial verbrannt, bleiben zwar seine kleinsten Bausteine (Atome) in Form von Abgas und Schlacke erhalten, diese werden aber nur bedingt wieder zu Pflanzen wachsen können, aus denen wir wieder Biokunststoff gewinnen. Aus den Abgasen (z. B. Kohlendioxide etc.) kann man sich das noch zum Teil vorstellen. Aus der Schlacke aus unseren Hochöfen oder Zementwerken eher nicht, da sie unkontrolliert kontaminiert sind. Wir wissen einfach zu wenig über das, was drin ist und noch weniger darüber, wie es wechselwirkt. Das ist eine Sackgasse, schont aber auch die Ölreserven in doppelter Hinsicht – beim Rohstoff, da Bio und bei der Energiegewinnung.
Momentan favorisieren viele die Mischung aus beiden Kreisläufen mit mehreren möglichen Abzweigungen in andere Kreisläufe, aber eben auch in Sackgassen wie die Verbrennung. Wird beispielsweise ein Biomaterial verbrannt, bleiben zwar seine kleinsten Bausteine (Atome) in Form von Abgas und Schlacke erhalten, diese werden aber nur bedingt wieder zu Pflanzen wachsen können, aus denen wir wieder Biokunststoff gewinnen. Aus den Abgasen (z. B. Kohlendioxide etc.) kann man sich das noch zum Teil vorstellen. Aus der Schlacke aus unseren Hochöfen oder Zementwerken eher nicht, da sie unkontrolliert kontaminiert sind. Wir wissen einfach zu wenig über das, was drin ist und noch weniger darüber, wie es wechselwirkt. Das ist eine Sackgasse, schont aber auch die Ölreserven in doppelter Hinsicht – beim Rohstoff, da Bio und bei der Energiegewinnung.