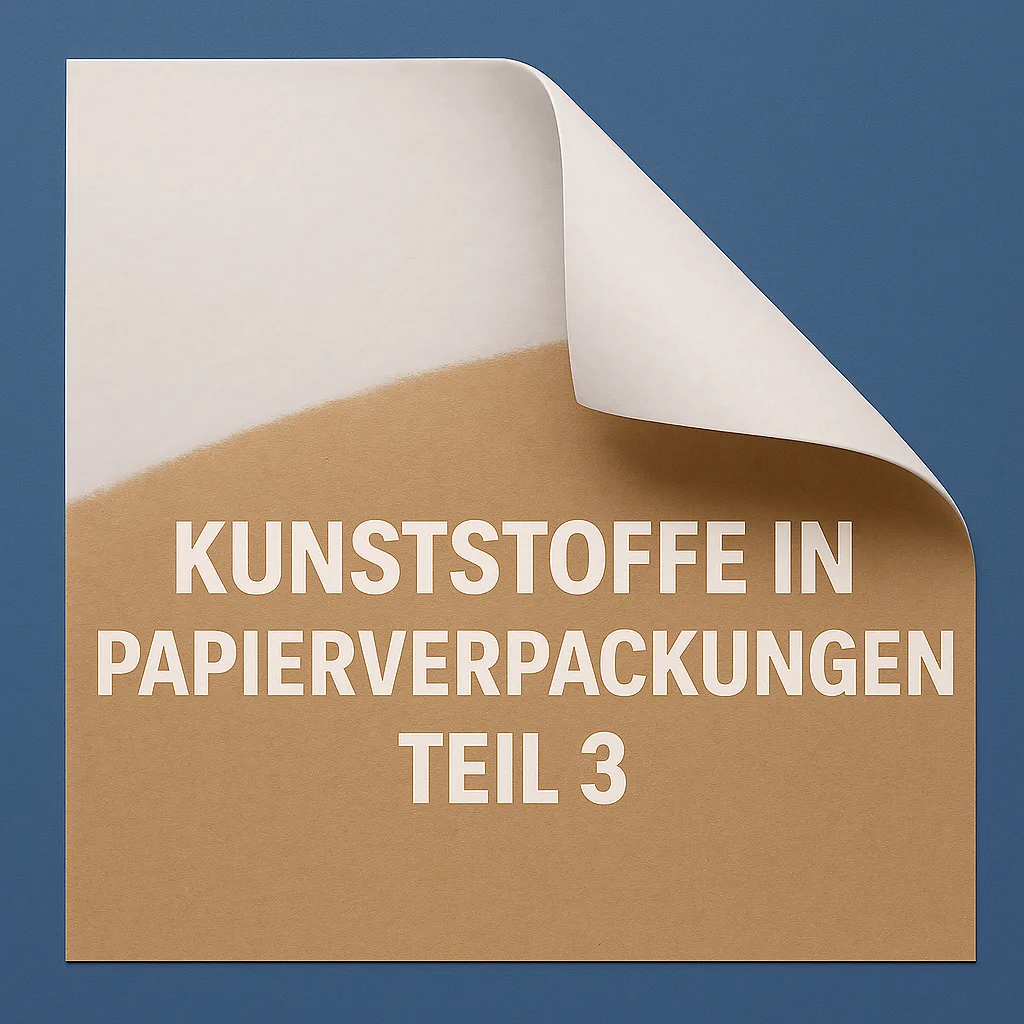Regulatorik, Umwelt und Entsorgung
Papierverpackungen gelten als nachhaltige Alternative zu Kunststoff – doch sobald eine Kunststoffbeschichtung ins Spiel kommt, wird die ökologische Bilanz komplex. Die ersten beiden Teile unserer Serie haben die Funktion von Kunststoffschichten in Papierverpackungen (Teil 1) sowie konkrete Kunststoffe und Alternativen (Teil 2) beleuchtet. Im dritten und letzten Teil unserer Serie geht es um die rechtlichen Rahmenbedingungen und Umweltaspekte, die für papierbasierte Verpackungen mit Kunststoffanteil entscheidend sind. Besonders im Fokus steht die EU-Einwegkunststoffrichtlinie (SUPD), die den Umgang mit Kunststoffanteilen in Papierprodukten wesentlich prägt. Ergänzend betrachten wir Fragen der Recyclingfähigkeit, Entsorgung und regulatorische Schnittstellen zur Lebensmittelkontakt- und Chemikaliengesetzgebung.
Die Einwegkunststoffrichtlinie (SUPD) – Bedeutung für beschichtete Papierprodukte
Definition und Zielsetzung
Mit der Richtlinie (EU) 2019/904, besser bekannt als Single-Use Plastics Directive (SUPD), verfolgt die Europäische Union das Ziel, die Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt – insbesondere auf Meere und Strände – zu verringern. Dabei geht es nicht nur um „klassische“ Plastikartikel, sondern ausdrücklich auch um faserbasierte Produkte mit Kunststoffbeschichtung oder -auskleidung.
Das heißt: Ein Pappbecher mit PE- oder PLA-Beschichtung, ein beschichteter Pappteller oder ein To-Go-Becherdeckel aus Papier mit Kunststofffilm gilt gemäß SUPD rechtlich als Kunststoffprodukt. Die Richtlinie setzt damit einen klaren Rahmen: Schon geringe Kunststoffanteile können den Charakter eines Papierprodukts wesentlich verändern – sowohl in regulatorischer als auch in ökologischer Hinsicht.
Konsequenzen für Hersteller und Inverkehrbringer
Für Unternehmen bedeutet das erhebliche Pflichten:
- Kennzeichnungspflicht: Seit 2021 müssen viele Papierprodukte mit Kunststoffanteil das Hinweiszeichen „enthält Kunststoff“ tragen (das sogenannte Schildkröten-Symbol). Dieses soll Verbraucher darauf aufmerksam machen, dass das Produkt Kunststoff enthält und nicht biologisch abbaubar ist.
- Erweiterte Herstellerverantwortung: Produzenten müssen künftig anteilig für die Reinigungskosten öffentlicher Flächen und für die Abfallbewirtschaftung ihrer Produkte aufkommen.
- Verwendungsbeschränkungen und Alternativpflichten: Für einige Produktkategorien (z. B. Einwegverpackungen im Take-away-Bereich) sind Kunststoffanteile künftig nur noch begrenzt zulässig – alternative Materialien oder Mehrwegoptionen werden politisch gefördert.
Damit hat die SUPD die Marktdynamik bei papierbasierten Verpackungen stark beeinflusst: Der Trend geht zu beschichtungsfreien oder polymerarmen Papieren, wasserbasierten Dispersionsbeschichtungen oder biobasierten, leichter abbaubaren Systemen.
Abgrenzung: Wann gilt ein Produkt als „Kunststoff“?
Die SUPD definiert Kunststoff als „Material, das aus einem Polymer besteht, dem Additive oder andere Substanzen zugesetzt wurden, und das als Hauptstrukturkomponente dient“. Für papierbasierte Verpackungen bedeutet das: Wenn die Kunststoffschicht funktional und nicht rein optisch ist – also z. B. als Barriere wirkt, fällt die gesamte Verpackung unter die Richtlinie.
Diese Definition betrifft vor allem:
- PE-, PP-, PET- und EVOH-Beschichtungen,
- biobasierte Kunststoffe wie PLA oder PBS.
Hiermit wird ein wichtiger Anreiz für Innovation in polymerfreien Beschichtungssystemen geschaffen.
Weitere regulatorische Bezüge
Auch wenn die SUPD im Vordergrund steht, sind weitere Rechtsrahmen für beschichtete Papierprodukte gegebenenfalls relevant:
- Verordnung (EU) Nr. 10/2011 – regelt die Verwendung von Kunststoffen im Lebensmittelkontakt. Kunststoffbeschichtungen auf der Lebensmittelkontaktseite müssen migrationsgeprüft sein und dürfen nur zugelassene Stoffe enthalten. Dies kann ich bestimmten Fällen auch auf Papier/Kunststoffverbunde angewendet werden.
- REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 – betrifft Chemikalien und Additive in Kunststoffschichten (z. B. Weichmacher, PFAS, Haftvermittler). Besonders besorgniserregende Stoffe können eingeschränkt oder verboten werden.
- Abfallrahmenrichtlinie (2008/98/EG) – fordert, dass Verpackungen recyclingfähig gestaltet werden („Design for Recycling“) und die Abfallhierarchie (Vermeidung > Wiederverwendung > Recycling > Verwertung) beachtet wird.
In der Praxis überschneiden sich diese Regelungen. Die SUPD definiert die Produktkategorie, während EU 10/2011 und REACH die Materialkonformität sicherstellen.
Umweltaspekte: Kunststoffbeschichtungen zwischen Funktion und Problem
Recyclingfähigkeit und Materialtrennung
Kunststoffbeschichtungen sind für viele Anwendungen technisch unverzichtbar – sie schützen vor Feuchtigkeit, Fett und Aromen und sichern die Siegelfähigkeit. Doch genau diese Funktionalität führt zu Problemen im Recyclingprozess.
Papierfabriken können den Faseranteil beschichteter Papiere nur dann effizient verwerten, wenn der Kunststoffanteil dünn, homogen und leicht ablösbar ist. Dicke oder komplexe Verbundstrukturen (z. B. PE-laminierte Papiere oder mehrlagige Barriereverbunde) führen zu hohen Reststoffanteilen, die energetisch verwertet werden müssen.
In Deutschland wird häufig die sogenannte 5-Prozent-Regel angewandt: Liegt der Kunststoffanteil über 5 % des Gesamtgewichts, darf das Produkt nicht über das Altpapierrecycling entsorgt werden, sondern gehört in den Verpackungsverbundstrom („Gelber Sack“).
Mikroplastik und Abbauverhalten
Gelangen beschichtete Papiere in die Umwelt, baut sich der Papieranteil relativ schnell ab – die Kunststoffbeschichtung jedoch bleibt zurück. Es entstehen Mikroplastikpartikel, die schwer oder gar nicht abgebaut werden.
Selbst kompostierbare Beschichtungen (z. B. PLA oder PHB) benötigen industrielle Bedingungen mit hohen Temperaturen, um sich vollständig zu zersetzen. In Heimkompost oder natürlichen Umweltbedingungen zersetzen sie sich meist nur unvollständig.
Energieverwertung und Lebenszyklus
Wenn Recycling technisch oder wirtschaftlich nicht möglich ist, werden Kunststoffanteile aus Papierverbunden meist thermisch verwertet. Dabei wird zwar Energie gewonnen, aber auch CO₂ freigesetzt, und der Materialkreislauf bleibt unvollständig.
Aus ökologischer Sicht schneiden Materialien am besten ab, wenn sie stofflich verwertet werden können – also in den Recyclingprozess zurückkehren. Hierfür sind vor allem dünne, sortenreine oder wasserlösliche Beschichtungssysteme vielversprechend.
Fazit
Die Einwegkunststoffrichtlinie hat die Verpackungsbranche nachhaltig verändert. Sie hat klargestellt: Papierprodukte mit Kunststoffanteil sind keine reinen Papierprodukte.
Kunststoffbeschichtungen erfüllen zwar wichtige technische Aufgaben, erschweren aber das Recycling, beeinflussen die Entsorgung und bringen Hersteller in den Anwendungsbereich der Kunststoffregulierung. Die Herausforderung liegt nun darin, funktionale Beschichtungen zu erhalten, ohne die Umweltbelastung zu erhöhen. Der Weg dorthin führt über Materialinnovation, Recyclingdesign und eine frühzeitige Auseinandersetzung mit den Anforderungen der SUPD – denn nur so kann papierbasiertes Verpackungsdesign langfristig regulatorisch konform, technisch sinnvoll und ökologisch tragfähig bleiben.
Autor: Dr. Daniel Wachtendorf, Innoform GmbH August 2025