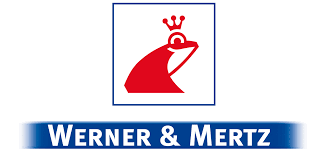Mit der Gründung und Markteinführung von yummypack setzt die Unternehmung yummypack neue Maßstäbe in der Verpackungsindustrie mit dem Angebot von individualisierbaren und nachhaltigen Verpackung für B2B und auch B2C Kunden.
Sie tragen auf der 6. Standbeutelkonferenz von Innoform vor. Was ist die Kernaussage Ihres Beitrages?
Die zunehmend globale Vernetzung und radikale Digitalisierung unserer Gesellschaft prägt maßgeblich den Wandel unseres Konsumverhaltens. Ein gegenläufiger Megatrend im Rahmen dieser Entwicklung ist der wachsende Wunsch nach Individualisierung und Personalisierung. Überwiegend zeichnen sich erfolgreiche Produkte dadurch aus, dass Kunden frühzeitig in den Produktentstehungsprozess mit einbezogen werden und so Produkteigenschaften, -funktionen und Serviceleistungen mit Kundenbedürfnissen verknüpft werden. Mass Customization wird, verstärkt durch die stetig wachsenden, technologischen Möglichkeiten, immer mehr zum Erfolgsmodell.
Viele Beispiele bekannter Marken der Konsumgüterindustrie, wie z. B. mymüsli, Nespresso, Nutella, Coca-Cola und Nivea zeigen auf, dass der Wunsch nach personalisierten Produkten auch in etablierten Konsumgütersparten Eingang findet. Das geschieht in Form neuer Produkte, Services oder auch Geschäftsmodellinnovationen, die die jeweilige Sparte ergänzen oder sogar grundlegend verändern können. Alle Unternehmen aus dem Bereich FMCG’s (Fast-Moving-Consumer-Goods), aber auch deren Zulieferer sowie die Verpackungsindustrie, sind gezwungen, sich mit dem Spannungsfeld zwischen Mass Production einerseits und Mass Customization andererseits auseinanderzusetzen.
yummypack zeigt mit einem neuen Plattform-Konzept, kombiniert mit nachhaltigen Standbeuteln – unseren yummypacks – wie durch neue technische Möglichkeiten ein neuer und alter Markt neu definiert und bedient werden kann.
Welche Zuhörerschaft wünschen Sie sich und warum?
Das Geschäftsmodell von yummypack steht im Grunde nicht in Konkurrenz zu bestehenden Marktteilnehmern. Es bietet vielmehr die Gelegenheit, durch Partnerschaft gemeinsam Bestands- und Neukunden, die z. B. losgrößenbedingt uninteressant sind oder kurzfristige Lieferungen bedürfen, bedarfsorientiert zu bedienen. Mit wachsendem Absatz bzw. Expansion suchen wir darüber hinaus Partner, die wir in unsere Prozesskette integrieren können. Auch wollen wir unsere Umweltperformance weiter steigern und suchen hierfür weitere Partner und Lieferanten.
Wie schätzen Sie insgesamt die Entwicklung des Standbodenbeutels (SUP) bezogen auf Ihr Tätigkeitsgebiet ein?
Der Standbodenbeutel ist ein ausgewogenes Multitalent: Er ist vergleichsweise preislich attraktiv, bietet Vorteile im Bereich Umwelt, Sicherheit und Gesundheit
und darüber hinaus besitzt er ein hohes Maß an Flexibilität und Verbraucherfreundlichkeit. Zusätzlich ist der Standbodenbeutel sowohl für den B2B als auch für den B2C Markt geeignet. Das sind beste Voraussetzungen, damit wir in unserem Markt wachsen können.
Warum haben Sie sich bei Ihrer Plattform für standardisierte Standbeutel entschieden und was kommt als nächstes?
Standbodenbeutel sind die absoluten Leichtgewichte unter den Verpackungen. Sie bieten hervorragende Eigenschaften insbesondere in Bezug auf Barriere, Convenience und Nachhaltigkeit. Mit dem verwendeten Papierverbund gehören yummypacks zu den umweltfreundlichsten Verpackungen ihrer Art. Sie kann man wie ein Fotobuch nach Belieben online auf unserer Plattform selbst und individuell gestalten und zu Hause selbst oder im mittelständischen Betrieb mit Maschinen befüllen. Die Erfolgsfaktoren sind: Yummy-Qualität in kundenindividuellen Yummypacks.
Neue technologische Möglichkeiten und Materialien wollen wir für noch mehr Nachhaltigkeit und noch individuellere Verpackungsformen einsetzen. So arbeiten wir beispielsweise bereits an einer Verpackung, die bis zu 100% aus nachwachsenden Rohstoffen besteht.
Worin sehen Sie die Gründe für das stetige Wachstum des Standbeutelmarktes?
Convenience, Sichtbarkeit im Regal, flexibler Einsatz, Preis und Umweltperformance sind nach unseren eigenen Marktforschungen die wichtigsten Erfolgsfaktoren im Markt. Darüber hinaus trägt aber auch die relativ einfache Herstellung und Weiterverarbeitung zum Erfolg dieser Verpackungsform bei. Flexibilität in Form und Verbund sowie in neuen technischen Möglichkeiten, wie zum Beispiel dem Digitaldruck, begünstigen darüber hinaus ein stetiges Wachstum des Standbodenbeutelmarktes.
Wie ordnen Sie den Standbeutel bezogen auf die Forderung nach Kreislaufwirtschaft ein?
Wir verfolgen mit unseren yummypacks eine besondere Form der Nachhaltigkeit und einen zweigleisigen Ansatz der Kreislaufwirtschaft.
Heute schon bestehen unsere yummypacks aus bis zu 80% nachwachsenden Rohstoffen. Derzeit setzen wir noch PET im Verbund ein, welchen wir aber bald durch alternative Lagen ersetzten werden, um auf bis zu 100% nachwachsende Rohstoffe zu kommen. Ein wichtiger Bestandteil – auch heute schon – ist dabei Papier. Dieses Papier ist FSC® zertifiziert – also aus nachhaltiger Forstwirtschaft.
Unser aluminiumfreier Papierverbund ist recyclebar und ähnelt einem Getränkekartonverbund, welcher – obwohl eine Aluminiumlage enthalten – als ökologisch vorteilhaft gilt. Die führenden Unternehmen der Kartonverbundindustrie setzten auch hier alles daran, die Recyclingquote stetig zu erhöhen und den ökologischen Fußabdruck auch durch Verbundoptimierung weiter zu senken. Diesen Pfad wollen wir ebenso mitgehen.
Doch auch der nicht recycelte Anteil eines Papierverbundes, welcher aus 100% nachwachsenden Rohstoffen besteht, sollte in ein positives Licht gerückt werden: Ähnlich einem Eigenheim mit einer Palletheizung wird eine traditionelle Müllverbrennungsanlage (die auch noch Schadstofffilter verwendet) plötzlich zu einem ökologisch ausgeglichenen, sinnvollen Energieerzeuger, oder nicht?
Welches Standbeutelkonzept hat Sie ganz besonders beeindruckt?
Im vergangenen Jahr haben viele Anbieter fast zeitgleich verschiedene Papierverbunde u. a. ohne Aluminium im Bereich Standbeutel für flüssige und haltbare Produkte auf den Markt gebracht. Überzeugt von der Nachhaltigkeit des Kartonverbund ist, haben wir einen zuverlässigen, d. h. bereits markterprobten, Papierverbund als nachhaltige Grundlage einer onlinebasierten Plattform in Kombination mit Digitaldruck gesehen. Nachhaltigkeit und Individualisierbarkeit sind dabei die wesentlichen Merkmale unseres Geschäftsmodells. So laufen bereits mit vielen Kunden spannende Konzepte und erste Tests, die diese Vorteile für sich nutzen.
Was empfehlen Sie einem Markeninhaber, der mit Pouches starten möchte?
Frei nach den neusten Methoden des Innovationsmanagements – einfach, aber systematisch testen. So erstellen wir losgrößenunabhängig für unsere Kunden yummypacks mit verschiedenen Verpackungsdesigns, um z. B. Testmärkte günstig und agil durchführen zu können. Co-Packer können darüber hinaus helfen, Investitionen in eigenes Abfüllequipment zeitlich zu verschieben – oder ganz zu vermeiden.
Darüber hinaus sollten neue technische Möglichkeiten genutzt werden, damit idealtypische Produktlösungen dem Kundenbedürfnis entspricht. So haben z. B. alle yummypacks individuelle QR Codes, mit denen nicht nur der Logistikprozess kontrolliert werden kann, sondern auch innovative Produktkonzepte mit ebenso innovativen Marketing- und Saleskonzepten, ähnlich wie z. B. dem Erfolgsrezept von mymüsli, kombiniert werden können.
Und dann noch eine private Frage: Was begeistert Sie außerhalb Ihrer beruflichen Tätigkeit?
Meine Familie.